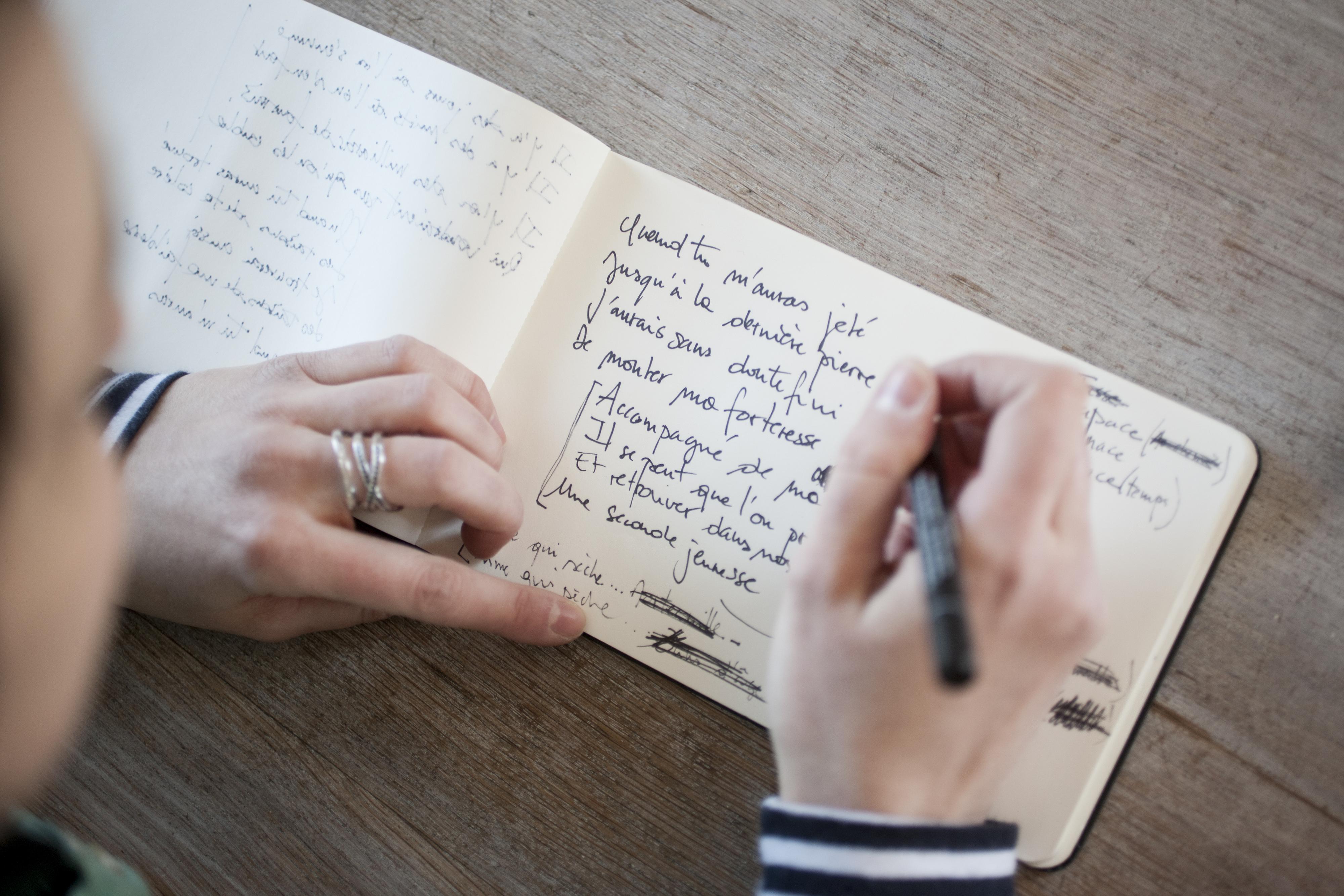Das Urheberrechtsgesetz
Am 1. April 2020 ist das revidierte Urheberrechtsgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz enthält unter anderem folgende Neuerungen:
Neue Massnahmen gegen die Piraterie wurden eingeführt:
Hosting-Dienste sind nun unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, dauerhaft zu verhindern, dass illegale Inhalte mithilfe ihrer Dienste erneut widerrechtlich zugänglich gemacht werden («Stay-Down»-Pflicht, Art. 39d URG); ausserdem dürfen die Rechteinhaberinnen und -inhaber Personendaten bearbeiten, soweit dies zum Zweck der strafrechtlichen Verfolgung von Piraten notwendig ist (Art. 77i URG).
Einige Massnahmen verbessern die kollektive Rechtewahrnehmung:
Die Werknutzerinnen und -nutzer müssen den Verwertungsgesellschaften ihre Meldungen elektronisch und in einer Form zur Verfügung stellen, die eine automatische Datenverarbeitung zulässt (Art. 51 Abs. 1 URG); die Verwertungsgesellschaften sind berechtigt, die von den Werknutzern erhaltenen Auskünfte untereinander auszutauschen (Art. 51 Abs. 1bis URG); das Beschwerdeverfahren gegen die Tarife wird beschleunigt (74 Abs. 2 URG), und die für die Genehmigung der Tarife zuständige Schiedskommission kann nun die Einvernahme von Zeugen anordnen (siehe neuer Art. 14 Abs. 1 lit. h des Verwaltungsverfahrensgesetzes).
Schliesslich wurde die «erweiterte Kollektivlizenz» in der Schweiz eingeführt (Art. 43a URG):
Auf diese Weise erhalten die Verwertungsgesellschaften die Möglichkeit, gewisse Verwendungen global zu bewilligen – auch im Namen von Rechteinhaberinnen und -inhabern, die sie vertraglich nicht vertreten – um die Rechtssicherheit der Nutzerinnen und Nutzer zu verbessern und die Vergütung für die Urheber sicherzustellen. Diese Möglichkeit betrifft Verwendungen, die die Rechteinhaberinnen und -inhaber nicht individuell kontrollieren können und bei denen die Verwertungsgesellschaften gewissermassen als eine Art «Versicherung» für die Nutzerinnen und Nutzer auftreten. Diese (in nordischen Ländern bereits bekannte) Neuerung ist zu begrüssen, zumal sie die Rolle der «Vermittler» unterstreicht, die die Verwertungsgesellschaften spielen.
Verlängerung der Schutzfrist im Bereich der verwandten Schutzrechte (Art. 39 URG):
Die Schutzdauer im Bereich der verwandten Schutzrechte wurde von 50 auf 70 Jahre nach Veröffentlichung der Aufnahme verlängert. Diese Neuerung betrifft Musik und Film – anders als im EU-Raum, wo die verlängerte Frist nur für die Musik gilt.
Einführung einer Video on Demand-Vergütung (Art. 13a und 35a URG):
Filme und Serien werden primär über Plattformen im Internet (Video on Demand) zugänglich gemacht. Vor diesem Hintergrund sieht das revidierte Gesetz vor, dass Urhebern (Regisseure, Drehbuchautoren) und ausübenden Künstlern (Schauspielende, Synchronsprechende) für die Nutzung ihrer Werke und Darbietungen eine Vergütung zusteht. Die VOD-Vergütung wird von den Verwertungsgesellschaften direkt bei den VOD-Anbietern einkassiert.
Kollektivverwertung: Darum braucht es Verwertungsgesellschaften
Dem URG liegt die Auffassung zugrunde, dass die aus der Urheberschaft fliessenden Rechte im Grundsatz durch die Berechtigten selbst wahrzunehmen sind. Nur dort, wo Massennutzung eine direkte Verwertung praktisch verunmöglicht, sieht das URG die kollektive Verwertung durch Verwertungsgesellschaften vor. Diese Gesellschaften sind gesetzlich verpflichtet, die zu ihrem Tätigkeitsgebiet gehörenden Rechte wahrzunehmen und also für die durch sie vertretenen Berechtigten tätig zu werden.
Weitgehende Kompetenzen
Innerhalb der Kollektivverwertung wird unterschieden zwischen der Verwertung der Ausschliesslichkeitsrechte selbst (z.B. das Recht der Kabelfernsehanbieterin, das Sendesignal des Fernsehens über Leitungen an ihre Kunden weiterzusenden) und der blossen Wahrnehmung des Vergütungsanspruchs (z.B. das Recht jeder Person, für sich privat eine Kopie einer Musik-CD anzulegen). Ausschliesslichkeitsrechte wirken absolut und ermöglichen den Verwertungsgesellschaften, Nutzungen zu verbieten. Demgegenüber gewähren Vergütungsansprüche lediglich eine einklagbare Geldforderung.